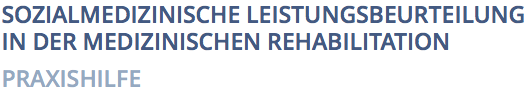Eine systematische Erfassung der Ausgangslage ist notwendig, um
- für jeden Rehabilitanden einen individuellen Therapieplan zu erstellen;
- berufliche Problemlagen rasch zu erkennen und schon während der Reha darauf abgestimmte Maßnahmen einzuleiten;
- den Reha-Erfolg am Ende beurteilen zu können.
Zur Erfassung der Ausgangslage gehört auch die erste Einschätzung der Leistungsfähigkeit zu Beginn des Reha-Aufenthalts.

Medizinische Anamnese
- Wie stellt sich der bisherige Krankheitsverlauf dar?
- Welche Diagnosen wurden bisher gestellt,
- welche Befunde erhoben,
- welche Therapiemaßnahmen durchgeführt und
- mit welchem Erfolg?
- Wie stellt sich der aktuelle Gesundheitszustand dar?
- Wie schätzt der Rehabilitand seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit selbst ein? Welche aktuellen Beschwerden schildert er?
- Bei Rehabilitanden mit chronischem Schmerzsyndrom sollte eine spezielle Schmerzanamnese erfolgen.
- Bei Rehabilitanden mit psychischen/psychosomatischen Erkrankungen sollten Sie eine ausführlichere biographische und Familienanamnese durchführen.
Die Erfassung der Anamnese kann durch Fragebögen erleichtert werden, die die Rehabilitanden im Vorfeld ausfüllen. Einige Beispiele für Rehabilitandenfragebögen finden Sie hier:
Berufliche Anamnese und Arbeitsplatzbeschreibung
- Wie ist das bisherige Berufsleben des Rehabilitanden verlaufen?
- Ist der Rehabilitand zurzeit arbeitslos? Wenn ja, wie lange schon? Welche Gründe gibt es dafür?
- Besteht aktuell Arbeitsunfähigkeit? Wenn ja, wie lange schon?
- Welche war die letzte versicherungspflichtige Tätigkeit bzw. die Tätigkeit, die die letzten Jahre geprägt hat?
- Welche Anforderungen stellt(e) dieser Arbeitsplatz an die Fähigkeiten des Rehabilitanden?
- Gibt es besondere physische oder psychische Belastungen an diesem Arbeitsplatz?
Eine möglichst genaue Arbeitsplatzbeschreibung ist zur Beurteilung des Leistungsvermögens essenziell: Berufliche Leistungsfähigkeit ist keine absolute Größe, sondern immer abhängig von den konkreten Anforderungen.
Dafür ist es wichtig zu erfassen, welche Tätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden müssen. Eine allgemeine Beschreibung des Berufsbildes („Berufsprofil“) ist nicht ausreichend und kann nur als erste Orientierung dienen. Für eine aussagekräftige und korrekte Leistungsbeurteilung kommt es darauf an, wie die tatsächlichen Bedingungen des Arbeitsplatzes gestaltet sind.
In den meisten Fällen wird es nicht möglich sein, den Arbeitsplatz zu besichtigen. Daher ist es wichtig, sowohl von Seiten des Rehabilitanden als auch von Seiten des Arbeitgebers Informationen einzuholen. Dabei ist zu bedenken, dass die Berichte von beiden Seiten subjektiv gefärbt sein können: Der Rehabilitand neigt möglicherweise dazu, problematische Bedingungen am Arbeitsplatz stärker zu betonen, während die Arbeitgeberseite evtl. eher dazu neigen wird, diese zu unterschätzen.
- Schon vor Reha-Antritt kann der Rehabilitand standardisierte Fragebögen zum Arbeitsplatz ausfüllen.
- Auch Fotos des Arbeitsplatzes, die der Rehabilitand mitbringen kann, sind eine gute Informationsquelle. Hierfür ist jedoch eine Erlaubnis des Arbeitgebers unbedingt notwendig.
- In der Anamnese können dann ergänzende Fragen zum Arbeitsplatz gestellt werden.
- Auch hier ist es wichtig, dass aus dem gesamten Reha-Team Informationen zum Arbeitsplatz zusammengetragen werden und in die Arbeitsplatzbeschreibung einfließen.
- Zusätzlich sollten auch Informationen von Arbeitgeberseite einfließen, wo immer dies möglich ist. Vereinzelt existieren auch offizielle Arbeitsplatzbeschreibungen des Arbeitgebers.
- Eine erste allgemeine Information zu bestimmten Berufsbildern bieten das Berufenet der Arbeitsagentur und der Wegweiser Arbeitsfähigkeit.
- In Absprache mit dem Rehabilitanden kann Kontakt zum Betriebsarzt aufgenommen werden.
Ausführliche Informationen zur Arbeitsplatzbeschreibung finden Sie auf der Website Berufliche Orientierung in der medizinischen Rehabilitation.
Besondere berufliche Problemlagen
Folgende Merkmale können auf besondere berufliche Problemlagen hinweisen:
- Der Rehabilitand war in der jüngeren Vergangenheit lange oder häufig arbeitsunfähig oder arbeitslos.
- Die subjektive berufliche Prognose des Rehabilitanden fällt negativ aus.
- Der Rehabilitand befürchtet, den Anforderungen des Arbeitsplatzes nicht gerecht werden zu können.
- Aus sozialmedizinischer Sicht ist eine berufliche Veränderung dringend erforderlich (DRV Bund, 2015).
Die genannten Kriterien können nur Hinweise geben, die Beurteilung sollte immer individuell erfolgen. Je nach Indikationsbereich ist bei 25 – 50 % der Rehabilitanden mit beruflichen Problemlagen zu rechnen.
- Checkliste zur Teilhabe am Arbeitsleben (CTA)
Die Checkliste zur Teilhabe am Arbeitsleben erhebt den subjektiven beruflichen Unterstützungsbedarf der Rehabilitanden (Download mit freundlicher Genehmigung der Rheintalklinik Bad Krozingen). - Würzburger Screening
Das Würzburger Screening (Löffler, Wolf, Gerlich, & Vogel, 2008) ermöglicht eine Einschätzung, ob eine berufliche Problemlage vorliegt und es einen Bedarf an beruflichen Rehabilitationsleistungen gibt. Sowohl die Fragebögen selbst als auch das Manual können Sie auf der Seite Berufliche Orientierung in der medizinischen Rehabilitation herunterladen.
- SIBAR
Das Screening-Instrument Beruf und Arbeit in der Rehabilitation dient der Identifikation beruflicher Problemlagen und des Bedarfs an berufsorientierten und beruflichen Rehabilitationsleistungen. Den Fragebogen zur beruflichen Belastung und Hinweise zur Auswertung können Sie auf der Seite Forschung und Beratung im Gesundheitswesen Karlsruhe herunterladen. Der Fragebogen befindet sich im Anhang der Publikation von Bürger und Deck (2009); die Erläuterungen zur Auswertung unter "SIBAR Instrument". - SIMBO
Der Simbo ist ein Screening-Instrument zur Feststellung des Bedarfs an Medizinisch Beruflich Orientierten Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation als Selbstauskunft des Rehabilitanden. Das Instrument einschließlich Manual und Auswertungshilfen gibt es als Papierversion zum Ausdrucken und als Online-Umfrage.
Kontextfaktoren
Es gilt, Förderfaktoren und Barrieren zu erkennen, die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben können.
In diesem Fall ist eine Leistungsbeurteilung von > 6 Stunden in der letzten Tätigkeit, aber gleichzeitig < 3 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich. Gäbe es dieses Beschäftigungsverhältnis nicht, käme die erhebliche Erwerbsminderung zum Tragen.
Bei einer solchen Konstellation ist eine Begründung, warum die aktuelle Tätigkeit nicht den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes entspricht, zwingend notwendig, ebenso die klare Darstellung der krankheitsbedingten Funktionseinschränkungen.
Weitere Informationen zur ICF in der Reha finden Sie im Kapitel International Classification of Functioning (ICF).
Funktionsfähigkeit
Psychische Komorbidität
Bei Verdacht auf komorbide psychische Störungen sollte eine psychologische Zusatzdiagnostik erfolgen. Hierfür eignet sich als erstes Screening unter anderem der frei verfügbare Gesundheitsfragebogen für Patienten PHQ-D (Patient Health Questionnaire, Deutsche Form).
PHQ-D
Auswertungsmanual zum PHQ-D
Einen guten Überblick über weitere psychodiagnostische Instrumente und das Vorgehen beim Vorliegen komorbider psychischer Störungen in der Rehabilitation bietet die Broschüre Psychische Komorbidität der Deutschen Rentenversicherung.
Auch die Broschüre Psychische Funktions- und Fähigkeitsbeeinträchtigungen in der somatischen Rehabilitation gibt gute Hinweise zur Erfassung psychischer Symptome und Fähigkeitsbeeinträchtigungen in der somatischen Rehabilitation, insbesondere zur Bedeutung psychischer Komorbidität für die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung.
Sollte sich der Verdacht auf eine komorbide psychische Störung erhärten, ist eine weitergehende Abklärung zu prüfen.
Kooperations- und Anstrengungsbereitschaft
Die Motivationslage des Rehabilitanden kann sich auf seine Kooperations- und Anstrengungsbereitschaft auswirken. Daher ist es wichtig, sich bereits zu Beginn der Reha damit auseinanderzusetzen. Das Gespräch zu den Reha-Zielen bietet eine gute Gelegenheit dazu, die Erwartungen, Wünsche und Ängste des Rehabilitanden zu klären. Wenn Rehabilitanden eingeschränkte Kooperationsbereitschaft zeigen, beeinträchtigt das den Reha-Erfolg und erschwert die Leistungsbeurteilung.
Kritische Motivationslagen
- Mangelnde Veränderungsmotivation (z. B. von „geschickten“ Rehabilitanden),
- Misstrauen aufgrund schlechter Vorerfahrungen,
- Angst vor Überforderung,
- Falsche Vorstellungen von Reha,
- Geringe oder fehlende Nutzenerwartung,
- Wunsch nach Erwerbsminderungsrente,
- Verminderter Antrieb und Anstrengungsbereitschaft durch psychische Störungen,
- Konflikte und andere belastende Situationen am Arbeitsplatz.
Die Vielzahl der genannten Gründe macht deutlich, dass nicht alle Rehabilitanden mit eingeschränkter Kooperations- und Anstrengungsbereitschaft „Rentenjäger“ sind. Ziehen Sie deshalb auch alternative Erklärungsmodelle für mangelnde Kooperationsbereitschaft in Erwägung.
Maßnahmen zur Erhöhung der Kooperationsbereitschaft
- Frühzeitige Rehabilitanden-Edukation
- zum Thema Leistungsbeurteilung,
- zu Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente und deren mutmaßliche Höhe,
- zum Umgang mit Konflikten und Stressbewältigung am Arbeitsplatz.
- Vertrauensbildende Maßnahmen:
- Versuchen Sie, die Beweggründe für mangelnde Motivation nachzuvollziehen und langsam Vertrauen aufzubauen. Gerade für misstrauische Rehabilitanden ist Transparenz und Offenheit besonders wichtig.
- Klären Sie ängstliche Rehabilitanden gut über das Konzept der Rehabilitation in Ihrer Klinik auf, z. B. auch über partizipative Zielvereinbarungen usw.
Stand 07/2019